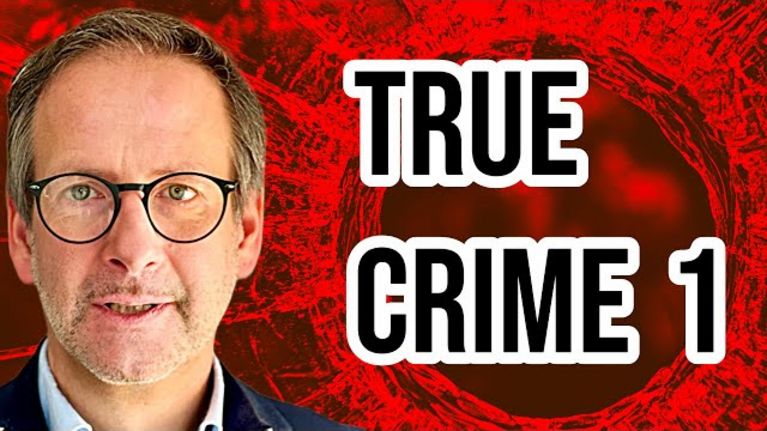a. Allgemeines Persönlichkeitsrecht (Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG)
Die Persönlichkeitsrechte bilden das zentrale Schutzinstrument für alle Personen, die in True-Crime-Formaten dargestellt werden, und stellen gleichzeitig die größte rechtliche Herausforderung für Medienschaffende dar. Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht findet seine Grundlage in dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gem. Art. 2 Abs. 1 GG und der Menschwürde des Art. 1 GG. Es dient der Konzeption des Bundesverfassungsgerichts nach, der Zusicherung eines autonomen Bereichs privater Lebensgestaltung, in dem der Einzelne seine Individualität entwickeln und wahren kann. „Hierzu gehört auch das Recht, in diesem Bereich „für sich zu sein“, „sich selber zu gehören“. Eine Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gewährleistet Einzelnen ein Selbstbestimmungsrecht darüber, wie sie sich in der Öffentlichkeit darstellen. Der Schutz reicht allerdings nicht so weit, „daß es dem Einzelnen einen Anspruch darauf verliehe, in der Öffentlichkeit nur so dargestellt zu werden, wie er sich selber sieht oder von anderen gesehen werden möchte. Jedenfalls wird er aber vor verfälschenden oder entstellenden Darstellungen seiner Person geschützt, die von nicht ganz unerheblicher Bedeutung für die Persönlichkeitsentfaltung sind.“
Schutz vor Verletzung der Privatsphäre, Intimsphäre - auch Ehrverletzungen
Das Persönlichkeitsrecht gliedert sich in verschiedene Schutzebenen, die unterschiedliche Intensitäten des Schutzes bieten.
Die Intimsphäre als innerste Schutzebene umfasst höchstpersönliche Lebensbereiche wie Sexualität, schwere Krankheiten, familiäre Konflikte und private Korrespondenz. Eingriffe in diese Sphäre sind grundsätzlich unzulässig und können nur in absoluten Ausnahmefällen gerechtfertigt werden. Für True-Crime-Formate bedeutet dies konkret, dass beispielsweise die Veröffentlichung von Liebesbriefen eines Mordopfers oder die detaillierte Darstellung privater Gewohnheiten eines Täters ohne ausdrückliche Zustimmung der Betroffenen oder ihrer Angehörigen rechtlich unzulässig ist.
Die Privatsphäre als mittlere Schutzebene erfasst das häusliche Umfeld, die Freizeitgestaltung, private Gewohnheiten und finanzielle Verhältnisse. Hier ist eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse möglich, die Hürden für eine Rechtfertigung sind jedoch hoch. In der Praxis bedeutet dies, dass Innenaufnahmen der Wohnung eines Täters oder detaillierte Darstellungen seiner finanziellen Situation nur bei besonderem öffentlichem Interesse und unter strengen Voraussetzungen zulässig sind.
Die Sozialsphäre als äußerste Schutzebene umfasst Berufstätigkeit, öffentliche Auftritte und gesellschaftliche Kontakte. Hier ist der Schutz am geringsten, dennoch bestehen auch in diesem Bereich Grenzen, die insbesondere bei der Darstellung von Personen relevant werden, die unfreiwillig in den Fokus der Öffentlichkeit geraten sind.
Besonders sensibel bei Opfern, Angehörigen und (mutmaßlichen) Tätern.
Die besondere Schutzwürdigkeit verschiedener Personengruppen in True-Crime-Formaten ergibt ich aus verfassungsrechtlichen und zivilrechtlichen Bestimmungen. Der Pressekodex dient lediglich als Richtschnur für journalistische Selbstkontrolle, hat jedoch keine rechtliche Verbindlichkeit.
Grundlagen des Opferschutzes:
Der Schutz von Opfern ergibt sich primär aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht nach Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG sowie dem Recht am eigenen Bild nach §§ 22, 23 KUG. Opfer sind grundsätzlich nicht als Personen der Zeitgeschichte anzusehen und genießen besonderen Schutz vor identifizierender Darstellung. Ein besonderes Informationsinteresse der Öffentlichkeit an der Abbildung von Opfern ist nur in ganz besonderen Ausnahmefällen anzuerkennen. Nach einem gewissen Zeitablauf können Opfer einen weitreichenden Anonymitätsschutz für sich in Anspruch nehmen.
Der Presserat stellte 2019 in seiner bisher einzigen Rüge gegen ein True-Crime-Format (“Stern Crime”) fest, dass die Veröffentlichung von Opferfotos und die namentliche Nennung einen schweren Verstoß gegen den Opferschutz darstellen. Besonders problematisch war die Darstellung minderjähriger Opfer. Der “Klassiker” bei Beschwerden zum Opferschutz ist die unerlaubte Übernahme von Fotos aus sozialen Medien ohne Erlaubnis der Betroffenen oder Angehörigen.
Angehörige:
Angehörige haben eigenständige Persönlichkeitsrechte, die jedoch nur bei unmittelbarer Betroffenheit greifen. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts werden Angehörige durch Berichterstattung nur dann in ihren eigenen Persönlichkeitsrechten verletzt, wenn ihre Persönlichkeitssphäre selbst zum Thema des Berichts gehört. Bloße “Reflexwirkungen” aufgrund persönlicher Verbundenheit zu der dargestellten Person bleiben schutzlos. Konkret bedeutet dies: Angehörige können eigene Persönlichkeitsrechte nur dann geltend machen, wenn sie selbst Gegenstand der Berichterstattung werden - etwa durch Namensnennung, Bildveröffentlichung oder detaillierte Darstellung ihrer persönlichen Verhältnisse. Das bloße Leid, das sie durch die Berichterstattung über das Opfer erfahren, begründet noch keine eigenen Abwehrrechte.
Beschuldigte und Verurteilte:
Beschuldigte und Verurteilte haben zunächst dieselben allgemeinen Persönlichkeitsrechte wie alle anderen Personen auch. Im Gegensatz zu Angehörigen sind sie durch True-Crime-Formate regelmäßig unmittelbar betroffen, da sie selbst Gegenstand der medialen Darstellung sind.
Grundsätzlich Wer den Rechtsfrieden bricht, muss sich nicht nur den hierfür verhängten strafrechtlichen Sanktionen beugen, sondern muss auch dulden, dass das von ihm selbst erregte Informationsinteresse der Öffentlichkeit auf den dafür üblichen Wegen befriedigt wird.
Zivilrechtlich können sich Beschuldigte und Verurteilte auf § 823 Abs. 1 BGB stützen, wenn ihre Persönlichkeitsrechte durch mediale Darstellung verletzt werden. Sie können Unterlassung, Widerruf, Schadenersatz und bei schweren Verletzungen auch Geldentschädigung verlangen. Dies gilt unabhängig davon, ob sie rechtskräftig verurteilt wurden oder ob das Verfahren noch läuft.
Bei laufenden Verfahren kommt zusätzlich die Unschuldsvermutung zum Tragen, die vorverurteilende Darstellungen verbietet. Auch bei bereits Verurteilten bleibt jedoch das allgemeine Persönlichkeitsrecht bestehen und kann Grenzen für die mediale Darstellung setzen, insbesondere wenn diese in die Privat- oder Intimsphäre eingreift oder ehrverletzenden Charakter hat.
Zusätzlich zu diesen allgemeinen Persönlichkeitsrechten genießen verurteilte Straftäter ein spezifisches Resozialisierungsinteresse, das verfassungsrechtlich in Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG verankert ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Lebach-Entscheidung von 1973 entschieden, dass Täter nach geraumer Zeit die Eigenschaft als relative Person der Zeitgeschichte verlieren und beanspruchen können, dass nicht mehr identifizierend über sie berichtet wird.
Das Resozialisierungsinteresse gewinnt mit zeitlicher Distanz zur Tat an Gewicht und kann eigenständige Unterlassungsansprüche gegen identifizierende Berichterstattung begründen. Für eine erneute identifizierende Darstellung muss ein Aktualisierungsgrund vorliegen - ein bloßes Jubiläum der Tat reicht nicht aus. Das Bundesverfassungsgericht hat betont, dass das Resozialisierungsinteresse besonders dann stark wiegt, wenn die Straftat verbüßt ist und der Täter sich um eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft bemüht.
Bei minderjährigen Beschuldigten oder Verurteilten ist der Schutz besonders hoch: Nach den allgemeinen medienrechtlichen und presserechtlichen Grundsätzen sowie dem Pressekodex dürfen Namen, Bilder oder andere identifizierende Merkmale von Jugendlichen grundsätzlich nicht veröffentlicht werden. Ziel ist es, die Entwicklung und Resozialisierung junger Menschen zu schützen – unabhängig vom Ausgang des Verfahrens.
b. Namensnennung und Bildveröffentlichung
Die Frage der Namensnennung und Bildveröffentlichung stellt in True-Crime-Formaten eine der komplexesten rechtlichen Herausforderungen dar.
Grundsatz: Anonymisierung (z. B. nur Initialen, verpixelte Bilder).
Für die Verbreitung oder öffentliche Zurschaustellung eines Bildnisses in den Medien bedarf es grundsätzlich der Zustimmung des Abgebildeten. Daraus ergibt im Umkehrschluss der Grundsatz der Anonymisierung. Vollständige Anonymisierung bedeutet die Verwendung von Initialen für Vor- und Nachname, die Verpixelung oder Unkenntlichmachung von Gesichtern, die Verfremdung charakteristischer Stimmen und das Weglassen spezifischer Ortsangaben, die eine Identifizierung ermöglichen könnten.
Unzureichend sind hingegen die Verwendung nur des Nachnamens mit Initialen des Vornamens, einfache Augenbalken bei charakteristischen Gesichtszügen oder die Nennung spezifischer Wohnorte oder Arbeitsstellen. Besondere Vorsicht ist bei der Kombination verschiedener Informationen geboten, die in ihrer Gesamtheit zur Identifizierung führen können, auch wenn jede einzelne Information für sich genommen unproblematisch erscheint.
Ausnahme: Öffentliches Interesse bei Prominenten oder bereits bekannten Fällen (z. B. „NSU-Prozess“).
Von der Anonymisierungspflicht bei Bildveröffentlichungen bestehen Ausnahmen nach § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG für „Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte“. Der Begriff “Zeitgeschichte” umfasst alle Angelegenheiten von öffentlichem Interesse, die zur allgemeinen Willensbildung beitragen. Entscheidend ist nicht die Person selbst, sondern das zeitgeschichtliche Ereignis, mit dem das Bildnis in engem Zusammenhang steht.
Für die Rechtmäßigkeit von Bildveröffentlichungen ist erforderlich, dass ein öffentliches Informationsinteresse besteht, das über die bloße Abbildung hinausgeht. Es erfolgt stets eine Einzelfallabwägung zwischen dem öffentlichen Informationsinteresse und dem Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten unter dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Das Bundesverfassungsgericht hat in der Lebach-Entscheidung den Grundsatz aufgestellt, dass bei aktueller Berichterstattung über Straftaten das öffentliche Informationsinteresse grundsätzlich Vorrang vor dem Persönlichkeitsschutz des Täters verdient. Wer durch eine Straftat den Rechtsfrieden bricht und dadurch Mitmenschen oder Rechtsgüter der Gemeinschaft angreift, muss grundsätzlich dulden, dass das von ihm erregte Informationsinteresse der Öffentlichkeit befriedigt wird. Diese Kontrolle durch die Medien dient auch dem Schutz des Täters im Strafverfahren.
Bei bereits bekannten Fällen von gesellschaftlicher Relevanz wie dem NSU-Prozess kann eine identifizierende Bildberichterstattung gerechtfertigt sein, wenn das öffentliche Informationsinteresse die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen überwiegt. Allerdings dürfen auch hier keine berechtigten Interessen des Abgebildeten verletzt werden.
Bei Tätern: Abwägung zwischen Informationsinteresse der Öffentlichkeit und Resozialisierungsinteresse.
Bei Beschuldigten und Verurteilten ist eine besonders sorgfältige Abwägung zwischen dem öffentlichen Informationsinteresse und dem verfassungsrechtlich geschützten Resozialisierungsinteresse erforderlich. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Lebach-Entscheidung von 1973 entwickelt, dass Täter nach geraumer Zeit die Eigenschaft als relative Person der Zeitgeschichte verlieren und beanspruchen können, dass nicht mehr identifizierend über sie berichtet wird.
Das Gericht stellte dabei fest, dass nach Abschluss der Strafverfolgung und angemessener Information der Öffentlichkeit weitere Eingriffe in den Persönlichkeitsbereich des Täters grundsätzlich nicht mehr gerechtfertigt werden können. Solche fortgesetzten oder wiederholten medialen Darstellungen würden eine erneute soziale Sanktion über die rechtlich verhängte Strafe hinaus bedeuten, was verfassungsrechtlich bedenklich ist.
Die Abwägung hängt von verschiedenen Faktoren ab: der Schwere der Straftat, der gesellschaftlichen Relevanz des Falls, dem zeitlichen Abstand zur Tat und dem aktuellen Status des Täters. Während unmittelbar nach der Tat ein starkes öffentliches Interesse bestehen kann, gewinnt das Resozialisierungsinteresse mit der Zeit an Gewicht, insbesondere nach Verbüßung der Strafe.
Erfordernis eines Aktualisierungsgrunds
Für eine erneute identifizierende Berichterstattung über bereits abgeschlossene Fälle muss ein sachlicher Aktualisierungsgrund vorliegen. Ein bloßes Jubiläum der Tat reicht hierfür nicht aus. Diese Anforderung ergibt sich unmittelbar aus der Lebach-Rechtsprechung, die klarstellt, dass nach ordnungsgemäßer Sanktionierung und öffentlicher Information weitere mediale Eingriffe eine unzulässige zusätzliche Bestrafung darstellen würden.
Erforderlich sind neue Entwicklungen wie Wiederaufnahmen von Verfahren, neue Erkenntnisse, erneute Straffälligkeit oder andere sachliche Gründe, die ein aktuelles öffentliches Interesse begründen. Diese Anforderung schützt sowohl Täter als auch Opfer und deren Angehörige vor einer endlosen Wiederverwertung ihrer Schicksale zu Unterhaltungszwecken.
c. Postmortales Persönlichkeitsrecht (Art. 1 Abs. 1 GG)
Das postmortale Persönlichkeitsrecht regelt die Fortwirkung persönlichkeitsrechtlicher Positionen nach dem Tod einer Person. Für True-Crime-Formate ist dieses Rechtsgebiet von erheblicher praktischer Bedeutung, da häufig verstorbene Opfer, Täter oder andere Beteiligte dargestellt werden.
Rechtliche Grundlagen und Abgrenzung
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG erlischt grundsätzlich mit dem Tod, da nur lebende Personen Träger von Grundrechten sein können. Über den Tod hinaus bleibt jedoch der Schutzauftrag aus Art. 1 Abs. 1 GG (Menschenwürde) bestehen. Das Bundesverfassungsgericht stellte bereits 1971 fest, dass es “mit dem verfassungsverbürgten Gebot der Unverletzlichkeit der Menschenwürde unvereinbar wäre, wenn der Mensch nach seinem Tode in seinem allgemeinen Achtungsanspruch herabgewürdigt oder erniedrigt werden dürfte”.
Streng genommen handelt es sich daher nicht um ein “postmortales Persönlichkeitsrecht”, sondern um einen “postmortalen Persönlichkeitsschutz”, der ausschließlich auf der Menschenwürde basiert und daher weniger umfassend ist als der Schutz zu Lebzeiten.
Ideelle und kommerzielle Bestandteile
Der postmortale Persönlichkeitsschutz umfasst zwei verschiedene Schutzbereiche mit unterschiedlicher Intensität und Regelungsstruktur:
Ideelle Bestandteile: Die ideellen Bestandteile schützen vor Verletzungen des allgemeinen Achtungsanspruchs und vor groben Verzerrungen des Lebensbildes. Der Schutz ist auf schwere Eingriffe beschränkt - es muss eine “grobe Entstellung des Lebensbildes” oder eine Verletzung der Menschenwürde vorliegen. Bloße Indiskretionen oder leichte Beeinträchtigungen fallen nicht darunter.
Wahrnehmungsberechtigt sind die nächsten Angehörigen (§ 22 S. 4 KUG analog), also Ehegatte, Lebenspartner, Kinder, hilfsweise Eltern, Geschwister und Enkel. Diese können nur Abwehransprüche (Unterlassung, Beseitigung) geltend machen, aber keine materiellen oder immateriellen Schadensersatzansprüche, da deren Genugtuungsfunktion beim Verstorbenen ins Leere ginge.
Kommerzielle Bestandteile: Die kommerziellen Bestandteile schützen vor der unbefugten wirtschaftlichen Verwertung der Persönlichkeit des Verstorbenen, insbesondere zu Werbezwecken. Diese Rechte gehen als Vermögenswerte auf die Erben über, die jedoch entsprechend dem ausdrücklichen oder mutmaßlichen Willen des Verstorbenen handeln müssen.
Bei Verletzung der kommerziellen Bestandteile können die Erben neben Abwehransprüchen auch materiellen Schadensersatz (etwa in Form fiktiver Lizenzgebühren) verlangen. Immaterielle Schadensersatzansprüche sind auch hier ausgeschlossen.
Unterschiedliche Schutzdauer
Die Schutzdauer variiert erheblich zwischen den verschiedenen Bereichen:
Kommerzielle Bestandteile: Der BGH hat die 10-Jahres-Frist des § 22 S. 3 KUG analog auf alle kommerziellen Bestandteile des postmortalen Persönlichkeitsschutzes angewandt. Nach zehn Jahren erlöschen diese Rechte vollständig.
Ideelle Bestandteile: Hier gibt es keine starre Zeitgrenze. Das Bundesverfassungsgericht formulierte: “Das Schutzbedürfnis schwindet in dem Maße, in dem die Erinnerung an den Verstorbenen verblasst und im Laufe der Zeit auch das Interesse an der Nichtverfälschung des Lebensbildes abnimmt.” Bei prominenten Persönlichkeiten kann der Schutz durchaus 30 Jahre oder länger bestehen.
Recht am eigenen Bild: Nach § 22 S. 3 KUG bedarf es zehn Jahre nach dem Tod nur noch der Einwilligung der nächsten Angehörigen für Bildveröffentlichungen. Nach Ablauf dieser Frist erlischt auch dieser Schutz.
Besondere Regelungen
Urheberpersönlichkeitsrecht:Das Urheberpersönlichkeitsrecht nach §§ 12 ff. UrhG besteht 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers fort und geht auf die Erben über.
Strafrechtlicher Schutz: § 189 StGB verbietet die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener und ergänzt den zivilrechtlichen Schutz um eine strafrechtliche Komponente.
Praktische Auswirkungen für True-Crime-Formate
Für True-Crime-Formate ergeben sich unterschiedliche Konsequenzen je nach beteiligter Personengruppe:
Verstorbene Opfer: Nach zehn Jahren erlischt der Bildnisschutz vollständig. Der ideelle Schutz besteht fort, greift aber nur bei groben Verzerrungen des Lebensbildes oder menschenwürdeverletzenden Darstellungen. Eine sachliche, respektvolle Darstellung des Schicksals verstorbener Opfer ist daher rechtlich meist zulässig.
Verstorbene Täter: Hier kann das Resozialisierungsinteresse noch zu Lebzeiten eine Rolle gespielt haben. Nach dem Tod gelten dieselben Grundsätze wie bei Opfern, allerdings können Angehörige bei groben Verzerrungen des Lebensbildes vorgehen.
Verstorbene Angehörige: Auch sie können vom postmortalen Persönlichkeitsschutz erfasst sein, insbesondere wenn sie in True-Crime-Formaten identifizierend dargestellt werden, ohne dass sie selbst zur Straftat in Beziehung standen.
Strukturelle Besonderheiten
Eine strukturelle Asymmetrie besteht darin, dass die Persönlichkeitsrechte verstorbener Personen zeitlich begrenzt sind, während lebende Täter oft dauerhaft durch das Resozialisierungsinteresse geschützt bleiben. Dies führt zu der paradoxen Situation, dass verstorbene Opfer nach einer bestimmten Zeit weniger Schutz genießen können als ihre noch lebenden Peiniger.
Der postmortale Persönlichkeitsschutz ist insgesamt schwächer ausgeprägt als der Schutz zu Lebzeiten, was dem Umstand Rechnung trägt, dass der Verstorbene selbst nicht mehr beeinträchtigt werden kann und gleichzeitig das öffentliche Interesse an historischer Aufarbeitung und Meinungsbildung zu berücksichtigen ist.